Boris Kehrmann
Operetta Research Center
1 December, 1999
Der Klassiker als Sittenverderber. Erstmals aus den Quellen aufgearbeitet: die deutsche Rezeptionsgeschichte Jacques Offenbachs im 19. Jahrhundert.
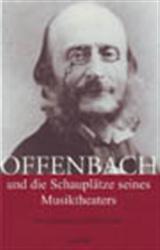
The cover of “Offenbach und die Schauplätze seines Musiktheaters.”
Die deutschsprachige Aufführungsgeschichte Jacques Offenbachs beginnt 1858 mit der unautorisierten Aufführungsserie der «Hochzeit bei Laternenschein» im Carl-Theater Wien. Um die hohen Tantièmen zu sparen – Offenbach war ein gewiefter Geschäftsmann – kaufte Direktor Carl Treumann einfach den Klavierauszug und liess ihn von seinem Kapellmeister Carl Binder instrumentieren. Als das Publikum das Werk drei Jahre später in der Originalinstrumentation unter Leitung des Komponisten kennenlernte, war man erstaunt über die, wie es in einer Rezension heisst, «viel diskretere Begleitung». Warum nur schätzten die Wiener den sinfonisch eingedickten Offenbach höher als das drahtige Pariser Original? Matthias Spohr gibt in seiner tiefschürfenden Recherche über den Ursprung der Wiener Operette, einem der Glanzstücke in dem von Rainer Franke herausgegebenen Sammelband «Offenbach und die Schauplätze seines Musiktheaters», eine differenzierte Antwort: die Wiener Operette hatte von Anfang an einen Hang zum Opernhaften. Denn: einerseits knüpfte sie an der Tradition des Singspiels (Hiller, Mozart) und der Spieloper (Lortzing, Nicolai) an; andererseits orientierte sie sich als honoriger Opernersatz des wirtschaftlich großgewordenen «kleinen» Mannes an der Hofoper. Die Bourgeoisie wollte sich von Volksstück und Posse, den vulgären Belustigungen derjenigen Schicht, aus der sie sich hochgearbeitet hatte, absetzen. Operette in Wien, das war eine Art «Hofoper light».
Das Gegenteil bekamen die Wiener vorgesetzt, als die «Bouffes Parisiens» Offenbachs Urinszenierung des «Orpheus in der Unterwelt» von der Seine an die Donau brachten: «Die Spielweise ist meistens derb bis zum äußersten», lesen wir in einer der für uns, die wir gerne dabei gewesen wären, so aufschlussreichen Kritiken: «Im Tanz sahen wir die tollste Ungebundenheit; Grazie fehlte dagegen so ziemlich ganz. [...] Offenbach selbst endlich stampfte beim Dirigieren so stark mit den Füßen und schlägt den Taktstock so heftig auf das Pult, daß es störend wird.» Hinter der hauseigenen «Darstellung mit Nestroy », bleibe all das natürlich «weit zurück».
Carl Binders Potpourri-Ouvertüre ersetzt übrigens noch heute in den meisten «Orpheus»-Aufführungen Offenbachs Original-Vorspiele von 1858 und 1874. So ungebrochen besteht die Wiener Tradition, die wir belächeln, fort.
Um auf die Frage der Offenbachschen Frivolität zurückzukommen: so delikat die Wiener in Sittlichkeitsfragen abwogen – Münchner Biedersinn konnten auch sie es nicht recht machen. «Die Schöne Helena ist in Sujet u. Musik im Typus der modernen Lascivität u. Negation aller sittlichen u. rechtlichen Ordnung», stellte der bayerische Zensor Pfister 1867 fest, aus dessen Gutachten Manuela Jahrmärker in ihrer Studie über die Münchener Offenbach-Rezeption ausführlich zitiert: «Die Übersetzung mußte viel von dem ursprünglichen französischen Humor u. Geist abstreichen. Hiedurch wird vieles plump, gemeine und schamlos. Bei alledem verdient Anerkennung, daß die Direction des Theaters sichtlich bestrebt war, das Stück möglichst dezent zu geben. Die Costüme enthüllten bei weitem nicht die Blößen so, wie es in Paris am Vaudevilletheater oder in Wien am Carltheater der Fall ist. In Paris u. Wien entkleidet sich Helena in der Nachtszene des II. Actes fast vollständig auf der Bühne. Hier fällt nur das Oberkleid u. darunter befindet sich anständiges Tricot. In Wien bringen die Darsteller die Masken lebender bekannter Persönlichkeiten. So z.B. der schwachsinnige Menelaus in der Maske des Kriegers Ferdinand des Gütigen. Hier ist nichts dergleichen bemerkbar. Richtig ist, und das gilt für alle Vorstellungen, daß schamlose Zweideutigkeiten bei der ursprünglicheren u. rohen Sinnlichkeit des Münchener Publikums einen größeren u. bedenklicheren Eindruck machen als dies bei den blasirten Parisern u. Wienern der Fall ist.” Mag man solch völkerpsychologische Mutmassungen auch dahingestellt sein lassen, die Münchner Akten, die Manuela Jahrmärker in aller Ausführlichkeit ausbreitet, bergen eine Fülle theaterhistorisch und -praktisch so kostbarer Informationen, wie diejenige, daß die Offenbach-Darsteller des 19.Jahrhunderts offenbar improvisierten und extemporierten was das Zeug hielt. Der Zensur machten sie damit das Leben schwer, doch hat der Fleiss der Beamten uns dafür manchen Bühnenwitz bewahrt. Übrigens liessen sich auch Persönlichkeiten des Hofes trotz allem nicht davon abhalten, die beanstandeten «Lüderlichkeiten» selbst in Augenschein zu nehmen.
Erst 1870/71ff. wurde für «alles Schöne, Liebe und Ehe, Rittertum und Romantik, Unschuld und Tugend» auch an der «Operettenfront» gekämpft und der «frivole Schund» der Franzosen durch leichte, aber sittsame und vor allem deutsche Unterhaltungsware verdrängt.
Wie Offenbachs Werke im 19.Jahrhundert in den Operetten-Zentren Wien und Berlin, an der Peripherie in Hamburg, München und Bad Ems, wo Offenbach regelmäßig zur Kur weilte, sowie in London aufgeführt, bearbeitet und aufgenommen wurden, wer sie gesungen, gespielt und besucht hat und welche Anstöße von ihnen ausgingen, das breitet Rainer Frankes mit seltenem Bild-Material reich ausgestatteter Sammelband in gelungenen und auch einigen weniger gelungenen Überblicksdarstellungen und Aufführungschronologien, in Statistiken und Dokumentationen aus, die größtenteils erstmals aus Archiv-, Bibibliotheks-, Zeitungsbeständen und Theaterzettelsammlungen systematisch und gründlich erarbeitet wurden. Mit Kapiteln über die Offenbach-Volesungen Karl Kraus’, mit einer minuziösen Rekonstruktion der Eröffnungsinszenierung der Komischen Oper Berlin 1905 mit «Hoffmanns Erzählungen» und der deutschen Aufführungsgeschichte 1933 bis 1945 stößt der Band zudem ins 20.Jahrhundert vor. So entsteht aus Tausenden von meist unbekannten Detailinformationen ein lebendiges Bild der Aufführungspraxis zu Offenbachs Lebzeiten wie es in dieser Fülle und Solidität bisher noch nicht vorhanden war. Immer wieder eröffnen sich bei der vergnüglichen Lektüre auch überraschende Seitenblicke auf Usanzen der Gegenwart.
Zwei seien zum Schluß mitgeteilt: wer glaubte, daß die «Drei Tenöre» ein neues Marketing-Modell entwickelt hätten, sieht sich in echt Offenbachscher Manier auf die «Drei Zwerge» verwiesen, ein Liliputaner-Trio, das Mitte des 19.Jahrhunderts unter anderem als Jupiter, Pluto und Styx im «Orpheus» in ganz Europa Furore und Kasse machte. Und: Berliner Opern-Intendanten können künftig ihre Doubletten-Politik unter Hinweis auf alte deutsche Theatertraditionen verteidigen: 1915 liessen Deutsches Opernhaus und Hofoper in Berlin ihre «Hoffmann»-Premieren im Abstand von anderthalb Monaten aufeinander folgen; in Hamburg verstrichen 1860 immerhin zwei Monate zwischen den «Orpheus»-Inszenierungen in Thalia- und Stadttheater, während das Altonaer Theater drei und das Carl-Schultz-Theater abermals fünf Jahre wartete; all das ist aber nichts gegen den Verdrängungskampf, den in den 1870er Jahren in München Gärtnerplatz-, Thalia- und Elysium-Theater gegeneinander kämpften, indem sie ihre Neuinszenierungen der gleichen Stücke auf den gleichen Abend legten. Sage da niemand, es sei aus der Geschichte nicht zu lernen.
Rainer Franke (Hg.): Offenbach und die Schauplätze seines Musiktheaters.
Laaber-Verlag, Laaber 1999 (Thurnauer Schriften zum Musiktheater,
Bd.17), 406 Seiten, 78 Euro
