Kevin Clarke
Tanz-Signale Wien
14 April, 2015
At the 2015 edition of Tanz-Signale in Vienna, devoted to Johann Strauss and his librettist Victor Léon, Kevin Clarke talked about Wiener Blut, gender models presented in that 1899 operetta and aspects such as sex addiction and women’s liberation. This is the full German text of his speech, in an online version.

The “golden” Johann Strauss statue in the Vienna Stadtpark. (Photo: Wikipedia)
Am 1. Jänner 1928 schrieb der Komponist Ralph Benatzky während eines Wien-Aufenthalts in sein Tagebuch: „Der Wiener hat kein Empfinden für Selbstironie. Er will die Süßigkeit des Steffl, die Schönheit seiner Stadt, die Goldigkeit seines Herzens immer wieder fingerdick um die Goschen geschmiert haben, und nicht Selbstpersiflage […] bitter ernst, betrachtet das als ein Unrecht, das ihm zugefügt wird und ‚schmollt‘ wie ein kleines Kind. Ganz anders der Berliner, der für Selbstsatire, für ‚Sichselbstverhohnepipeln‘, und nur für das eigentlich, das meiste übrig hat!“
Ein Stück wie die 1899 im Wiener Carl-Theater uraufgeführte Operette Wiener Blut, die im Text der Librettisten Victor Léon und Leo Stein dem Zuschauer wieder und wieder alle „Goldigkeiten“ der österreichischen Hauptstadt um die Goschen schmiert, kann bei oberflächlicher Betrachtung schnell den Eindruck einer überzuckerten Nostalgie-Operette erzeugen. Man könnte glauben, es mit einem aus der Zeit gefallen Werk zu tun zu haben, das im frühen 19. Jahrhundert spielt und eine gleichfalls aus der Zeit gefallene absurde Verwechslungskomödie präsentiert, die banal bis zum Äußersten ist und vollkommen realitätsfern scheint. Was allerdings am Erfolg gerade dieser Operette in der Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden beigetragen hat.
Weil das traumatisierte Operettenpublikum der Kriegs- und Nachkriegsjahre genau jene zeitliche Entrücktheit, Harmlosigkeit und Heile-Welt-Aura an Wiener Blut schätzte. Sie entsprach dem, was Alexander Witeschnik in seinem Buch Musik aus Wien noch 1955 als PR-taugliches Ideal der Operette und der Stadt Wien verkündete: „Es gibt wohl eine Musik der Nationen, aber es gibt keine Musik der Städte. […] Einzig [Wien] hat die musikalische Kraft einer ganzen Nation. […] Wien lebt am Herzen der Natur. Heute wie vor tausend Jahren. […] Die Donaustadt hat Zeit. Es fehlt ihr die Hast, mit der andere Weltstädte dem Schrei des Tages erliegen. […] Heiterkeit, Daseinsfreude, gesunde Naivität – Wesenskräfte der Stadt – gaben den natürlichen Nährboden [für die Operette]. Ureingeborener Spieltrieb und ein melodisches Vermögen von olympischer Leichtigkeit den seelischen Prospekt.“
Die Referenz zu den „tausend Jahren“ ist sicher nicht zufällig. Auch nicht die Betonung der Veredelung der Operette durch Johann Strauss, um den es hier geht, im Vergleich zum sittengefährdenden jüdischen Original Offenbach. „Es begab sich das mozartische Wunder, daß der musikalische Impuls der Stadt die Operette aus den Niederungen des Sujets emporriß, daß die Urkraft der Melodie – eine Diesseitsmelodie von gnadenhafter Bezauberung – die Schablone durchblutete, verlebendigte und die ganze zweifelhafte Gattung in den Vorhof der großen Kunst hinauftrug.“
Das heiter-unbeschwerte, naturverbundene, entschleunigte Wien-Bild – oder besser gesagt: Alt-Wien-Bild – das sich in der Operette Wiener Blut findet und die „gnadenhafte bezaubernde Strauss-Musik“ hatten schon die Nationalsozialisten in ihrem ideologischen Kampf um eine Neudeutung des Genres Operette entschieden in den Vordergrund gerückt. Das spiegelt sich auch in Willi Forsts Verfilmung von Wiener Blut aus dem Jahr 1942 wider, wo Willy Fritsch und Maria Holst das Ehepaar „Graf und Gräfin Wolkershein“ spielen, mit geradezu „olympischer“ Keuschheit, die selbst eine nackte Tänzerin aus der antiken Sagenwelt in der großen Ballszene nicht aufwiegen kann.

The Willy Forst movie “Wiener Blut” featured on the cover of “Film-Kurier”, 1942.
Zu der Forst’schen Wien- und Operetten-Sicht schrieb Goebbels am 3. April 1942 in sein Tagebuch: „Man könnte angesichts dieses Films vor Neid erblassen, unter anderem wenn man bedenkt, wie wenig in dieser Beziehung für die Reichshauptstadt getan wird. Für die Weltgeltung der Wiener sind wirklich die besten propagandistischen Kräfte am Werk. Der Film ist mit Schmiß und Grazie gemacht. Er stellt ein Wien dar, wie es gern sein möchte, aber leider nicht ist.“

Cover of the DVD version of “Wiener Blut” starring Ingeborg Hallstein and René Kollo. (Photo: Deutsche Grammophon)
Über dieses Wien, das „leider nicht ist“ und das man in Wiener Blut zu sehen bekommt, zumindest in Inszenierungen wie der von Willi Forst (wo niemand geringeres als die Wiener Philharmoniker aufspielen), aber auch in der gängigen DVD-Ausgabe mit Ingeborg Hallstein, René Kollo und Dagmar Koller von 1971 (Inszenierung: Hermann Lanske, Dirigent: Anton Paulik), könnte man viel erzählen.
Ausführliches Material dazu gibt es im Katalog Alt-Wien: Die Stadt, die niemals war, basierend auf der gleichnamigen Ausstellung des Wien-Museums von 2004. Auch Marion Linhardt geht auf das Phänomen in ihrem Buch Residenzstadt und Metropole: Zu einer kulturellen Topographie des Wiener Unterhaltungstheaters (1858-1918) ein. Zur NS-Dimension von Strauss und Wiener Blut empfehlen sich diverse Bücher, u.a. Operette unterm Hakenkreuz, herausgegeben von der Staatsoperette Dresden. Und zu Willi Forsts Wien-Filmen finden sich ebenfalls zahlreiche Veröffentlichungen, speziell auch zu Wiener Blut.
ABBA, Strauss & Sexsucht
Statt den Nostalgie- oder Nazi-Elementen von Wiener Blut hier nun nochmals nachzugehen, möchte ich lieber auf einige der modernen und zukunftsweisenden Aspekte dieser Operette eingehen, die bislang kaum untersucht wurden, meiner Meinung nach aber mindestens ebenso spannend sind. Zum einen ist Wiener Blut, als Stück, das aus erfolgreichen Melodien eines bekannten Komponisten neu zusammengesetzt ist, geradezu der Prototyp dessen, was im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert im kommerziellen Unterhaltungstheater als alles andere dominierender Trend zu beobachten ist.
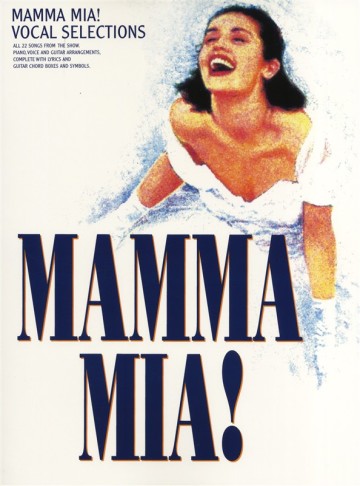
Vocal selections for the 1999 musical “Mamma Mia.”
Seit dem Mega-Erfolg von Mamma Mia 1999, basierend auf Liedern der schwedischen Pop-Gruppe ABBA, erleben Recycling-Musicals einen beispiellosen Boom. Inzwischen wird nahezu alles zu neuen Musicals verarbeitet, was auch nur irgendwie zum allgemeinen popkulturellen Liedgut gehört: im deutschen Sprachraum wäre an Udo Jürgens und Ich war noch niemals in New York zu erinnern, international an Queen (We Will Rock You), All You Need Is Love mit Musik von den Beatles usw. Die Liste ließe sich geradezu endlos fortsetzen.
Man könnte sagen, die Operette Wiener Blut, 100 Jahre vor Mamma Mia uraufgeführt, ist geradezu die Blaupause für all diese späteren Werke. Genau wie sie die Blaupause war für die vielen Alt-Wien-Operetten, die bewusst die Musik von Strauss aufgriffen, etwa Casanova (1928) oder Walzer aus Wien/The Great Waltz (1930), oder Musik von anderen sogenannten Alt-Wiener-Komponisten wie Schubert verarbeiteten, etwa in Das Dreimäderlhaus, eine der erfolgreichsten Operetten des 20. Jahrhunderts.
Wirklich bahnbrechend erscheint mir jedoch Wiener Blut vor allem im Zusammenhang mit zwei anderen Fragen: Welche Gender-Modelle werden im Stück an der Schwelle zum 20. Jahrhundert vorgestellt? Und: Kann man den umtriebigen und rastlos umherirrenden Grafen Zedlau als Beispiel für einen Sexsüchtigen in der Operette deuten, dessen Charakter vergleichbar ist mit dem von Brandon im Film Shame von Regisseur Steve McQueen von 2011; dort dargestellt von Michael Fassbender?
Fangen wir ausnahmsweise mit den Männern an, schließlich gehören die ja ebenfalls zum Bereich Gender Studies, gerade heute, wo nicht mehr eindeutig geklärt ist, was „Mann“ und „Frau“ bzw. „männlich“ und „weiblich“ ausmacht. In Wiener Blut treten folgende zentrale Charaktere auf, die sich selbst als „männlich“ identifizieren: Fürst Ypsheim-Gindelbach, Premierminister von Reuß-Schleiz-Greiz; Balduin Graf Zedlau, Gesandter von Reuß-Schleiz-Greiz; und Josef, der Kammerdiener des Grafen.
Diese drei Figuren entsprechen recht genau dem, was man von ihnen in einer Operette oder Alt-Wiener-Typenkomödie erwarten würde: ein auf Etikette und Moral pochender Minister aus einem kleinen, provinziellen Fürstentum, dem das, was als großstädtisches „Wiener Blut“ gepriesen wird, definitiv fehlt. Und der auf die Wahrung von althergebrachten gesellschaftlichen Normen besteht – Ehe, Monogamie, untergeordnete Rolle der Frau. Kurz, ein Beharren auf dem patriarchalen status quo, für dessen Wiederherstellung auf europäischer Ebene auch der Wiener Kongress bekannt ist, zu dessen Zeit die Operette 1815 spielt. Es ist ein gesellschaftlicher status quo, der sich mit Bezug auf die Rolle und Position der Frau innerhalb und außerhalb der Ehe um 1899 allerdings im Umbruch befand. Was Victor Léon als langjährigem Redakteur der Zeitschrift Die Hausfrau – dem „Organ für die gesamten Fraueninteressen“ – wusste.

Suffragette „Mrs. Suffern“ with her banner, 1914 in New York. (Photo: Wikipedia)
Die Hausfrau erschien von September 1877 bis Dezember 1884. Herausgeber war der mit Léon verwandte Julius Popper, Léons Vater Jakob Heinrich Hirschfeld und auch ein Onkel Léons schrieben regelmäßig Beiträge. Léon firmierte bis zum 8. Januar 1879 als „Redacteur“. Die Léon-Biografin Barbara Denscher merkt zum Themenspektrum der Publikation an: „Das Zielpublikum der Hausfrau waren Frauen der liberalen, gebildeten Mittelschicht. Die Zeitschrift trat für das Frauenwahlrecht ein; forderte ein modernes Scheidungsrecht; verwies regelmäßig in Artikeln auf die Notwendigkeit, Frauen alle Bildungsmöglichkeiten zu öffnen, berichtete eingehend über die Aktivitäten der verschiedenen Frauenvereine und brachte z.B. in den Ausgaben vom 13.10.1877 und 20.10.1877 (Jg. 1, Nr.4 und Nr. 5, jeweils Seite 1-2) ausführliche Berichte über den ‚Frauentag in Hannover‘, der organisiert vom Allgemeinen deutschen Frauenverein vom 27. bis 29.9.1877 stattfand und auf dessen Tagesordnung u.a. Fragen des Wahlrechts, der Berufsausbildung und des Studiums von Frauen standen.
Teilweise waren diese Artikel nicht signiert, z.B. jene über das ‚Wahlrecht für Frauen in Canada‘ (8.9.1877, S. 5), über einen ‚mathematischen Curs für Damen‘ an der Wiener Technischen Universität (22.9.1877, S. 3) oder über den Plan, Frauen in London ‚das Studium der Rechte zu ermöglichen‘ (29.9.1877, S. 3), d.h. möglicherweise wurden sie von Léon als leitendem Redakteur verfasst.“ Man kann also definitiv davon ausgehen, dass Léon über die sich im Wandel befindliche Situation der Frau im Fin de Siècle bestens unterrichtet war und diesen Wandel auch aktiv mit beförderte, auch in seinen Operetten, in denen er viele der genannten Punkte wieder und wieder aufgriff.
Der zweite zentrale männliche Charakter in Wiener Blut ist Graf Zedlau: ein umtriebiger Ehemann, der mehr oder weniger getrennt von seiner adeligen Ehefrau lebt, um stattdessen mit einer offiziellen Mätresse ein eheähnliches Verhältnis zu führen, aus dem er bei jeder Gelegenheit ausbricht, um Probiermamsellen und anderen nur mit Vornamen erwähnten Frauen hinterher zu eilen. Ein klassischer „Hallodri“, wie es an verschiedenen Stellen heißt, den das „Ehejoch“ drückt, der aber meint, trotzdem den „Schein“ wahren zu müssen. Genauso wie er den Schein einer intakten Mätressenbeziehung wahren will. Vermutlich, weil das von ihm in seiner sozialen Position erwartet wird.

Scene from the 1933 Max Ophüls movie “Liebelei,” based on the Schnitzler play (1895) about a so called “süßes Mädel” that is the mistress of an officer. The affair ends tragically, for all invoved.
Dann gibt es einen ergebenen Kammerdiener, der selbst mit einem Mädchen aus dem Dienstgewerbe liiert ist und um deren Respektabilität besorgt ist, während er gleichzeitig seinem Grafen umstandslos hilft, ein Rendezvous mit solch einer Probiermamsell auszumachen. Man könnte hier eine gewisse Doppelmoral konstatieren, die ebenfalls zeittypisch für Männer ist.
Der Wienerwalzer als Metapher für Fortschritt
Dieser vergleichsweise konventionellen Herrenriege (zu der auch Kagler und Graf Bitowski gehören) wird eine Gruppe von Damen gegenübergestellt, die zwar entsprechend sozial abgestuft sind, sich aber jeweils genau anders verhalten, als man es von ihnen erwarten würde. Da ist zuerst die Gräfin Zedlau. Statt ihrem Mann böse zu sein, dass er sie betrügt, erklärt sie ihm geradeheraus, dass ihr der ursprünglich „strenge“ und „solide“ Herr aus Reuß-Schleiz-Greiz nicht „keck“ genug war, so dass ihr der „flotteste Don Juan“, zu dem er inzwischen mutiert ist, deutlich besser gefällt. Was sie im Kontext der geradezu zur Revolutionshymne erhobenen Titelmelodie verkündet.
Die Folge solch ungewöhnlicher moralischer Einstellungen: der Graf fürchtet, sich am Ende noch in die eigene Ehefrau zu verlieben. Das liegt auch daran, dass sich die Gräfin genauso benimmt, wie man es von einer verständnisvollen Geliebten erwarten würde, wie sich aber die offizielle Geliebte im Stück (= Franzi) nicht verhält. Im Gegenteil, ihr fällt die Rolle der dauereifersüchtigen und dauergekränkten „Gattin“ zu, was besonders komisch ist, wenn man bedenkt, dass sie Balletttänzerin ist und damit quasi direkt aus dem Halbwelt-Milieu stammt, wo man mehr Toleranz erwarten könnte.
Und dann ist da als Dritte die Pepi. Dem Klischee gemäß würde sie als eine von „solchen Schneidermamsellen“ es in Fällen der Annäherung von Grafen „net so streng“ nehmen, wie Josef seinen Herrn belehrt. Der Witz ist allerdings, dass ausgerechnet Pepi „hübsch solid“ und „gar so fad“ daherkommt, wie man es von der Gräfin erwarten würde, nicht von einem einfachen Kind aus dem Volk, das unverhofft die Vorzüge eines moralisch einwandfreien Lebenswandels propagiert. D.h. das erwartete Verhalten ist genau spiegelverkehrt zur Achse der gesellschaftlichen Position der Damen. Aus dieser Diskrepanz entwickelt die rasend schnell abspulende Screwball Comedy ihre Wirkung und ihren Reiz.
Sie verdeutlicht auch, dass sich zumindest auf Frauenseite das Selbstbild der Stände verändert, wir also eine Phase der Neuorientierung präsentiert bekommen, die eher für 1899 typisch ist statt für 1815, mit dem Titelwalzer als Metapher für Fortschritt, um den alles im Innersten kreist.
Während schlussendlich die „solide“ Pepi den gleichfalls soliden Kammerdiener Josef kriegt und die ambitionierte Franzi sich den gesellschaftliche Position und Langeweile versprechenden Minister angelt, sind Balduin und Gabi, Graf und Gräfin Zedlau, ein aus heutiger Sicht äußerst modernes Ehepaar. Sie plädiert für eine offene Ehe, in der sein Triebleben aus der eigenen Beziehung zueinander ausgelagert ist, wo aber die mit dem Ausleben von solchen Trieben verbundene Spannung als positiv fürs Zusammensein eingestuft wird. So positiv, dass die Gräfin unter diesen Umständen sogar nach Wien zurückkehrt, um mit ihrem Mann neuerlich zusammenzuziehen, den sie ja vorher gerade deswegen verlassen hatte, weil ihrer Meinung nach die Verbindung von einem „echten Wiener Blut“ (= einer modernen Frau) und einem Herrn aus Reuß-Schleiz-Greiz (= einem reaktionären Ewiggestrigen) „einer Ehe nicht gut tut“. Wobei sie Ehe nicht mit Monogamie gleichsetzt, sondern als gleichberechtigte Partnerschaft sieht, auch in Bezug auf jeweils individuelle Liebesabenteuer.
Für ein Ehepaar im katholischen Österreich, sowohl zu Zeiten des Wiener Kongresses als auch im Uraufführungsjahr, sind das explosive Gedanken, die die Gräfin da verkündet. Im Grunde wurden sie erst in den 1970er Jahren im Zuge der Zweiten sexuellen Revolution ernsthaft öffentlich diskutiert und sind bis heute in vielen Teilen der westlichen Welt nicht allgemein durchgesetzt. Von den Zuständen in islamisch geprägten Ländern möchte ich hier gar nicht erst anfangen zu sprechen.

Still from the movie “Bob & Carol & Ted & Alice,” 1969. It is about wife swapping, infidelity, and other types of experimentation with interpersonal relationships. (Photo: Wikipedia)
Um das komische Potenzial all dieser Figuren deutlich zu machen und damit auch die Wirkung des Stücks zu ermöglichen, ist es nötig, das teils bis zur Karikatur überzeichnete der entworfenen Gender-Modelle klar auszuspielen und sich nicht auf die „olympische Leichtigkeit“ und das „mozartische Wunder“ der Johann-Strauss-Musik zu konzentrieren. Letzteres geschah laut Pressebereichten bei der Uraufführung, mit den bekannten negativen Folgen. Erst als das Stück 1905 neu auf die Bühne des Theaters an der Wien kam, im Vorfeld der „übersexualisierten“ Lustigen Witwe (ebenfalls auf ein Libretto von Léon/Stein), wurde Wiener Blut ein durchschlagender Erfolg und internationaler Hit.
Als 2008 die Regisseurin Cordula Däuper Wiener Blut in Berlin unter gänzlichem Verzicht auf Nostalgie, Goldigkeit und Süßigkeit inszenierte, stattdessen als Persiflage, in der alle Rollen von weiblichen Darstellerinnen übernommen wurden, gelang es, das Explosive und Moderne der Geschlechterkomödie besonders deutlich auszuspielen.
Über die Wirkung der Inszenierung schrieb Rezensent Wolfgang Fuhrmann in der Berliner Zeitung: „Natürlich fürchtet man sich ein bisschen, wenn man hört, dass die Hauptrollen allesamt mit Frauen besetzt sind und dann auch noch ein Judith-Butler-Zitat über ‚die heterosexuelle Matrix der Geschlechterrollen‘ als einzige Information im Programmheft findet. Das klingt doch freudlos, nach Reuß-Schleiz-Greiz gewissermaßen. [Aber:] Wie sich die Körper, Texte und, ja, die ‚heterosexuelle Matrix der Geschlechterrollen‘ verheddern, das ist ausgesprochen lustig, es ist fröhlichste Geschlechterwissenschaft. […] Mit Geschlechterinsignien wird gespielt. […] Im Übrigen sind die Damen alle […] zum Fressen süß. […] Insgesamt gelingt es dem Abend bis hin zum wahrhaft himmlischen Schlussbild, die Liebe zur Operette in all ihrer Widersprüchlichkeit zu wahren. So dass man auch am nächsten Tag noch ohne schlechtes Gewissen vor sich hinsummen kann: ‚Wiehner Bluut, Wiehner Bluut, schuh-schu-schuuh, schu-schu-schuuh, schu-schu-schuuh.‘“
Wahrheiten über das Lebensgefühl des 21. Jahrhunderts
Apropos „zum Fressen süß“: Eine weitere Besonderheit des Stücks ist es, dass die männliche Hauptfigur des Grafen Zedlau ein extrem auffälliges Triebleben hat. Nicht nur nennt er selbst sich einen „Don Juan“, der es „in der kurzen Zeit“ wirklich „weit“ gebracht habe. „Heute ist’s Sophie, morgen dann Marie, wie am nächsten Tag sie wohl heißen mag? Im Kalenderbuch ich vergebens such nach dem Frauennamen, den es gibt, den ich noch nicht geliebt!“ Franzi konstatiert: „Täglich wird es schlimmer, denn Frauenzimmer sind’s doch immer, die den Herrn halten fern!“
Sogar im größten Chaos und unter extremem Druck, der auf ihn ausgeübt wird, ergibt sich der Graf der „Tyrannei der Lust“ und verschwindet, um abermals zu versuchen, ein x-beliebiges Frauenzimmer in einem x-beliebigen Kleidungsgeschäft zu erobern. Obwohl er weiß, dass dieses Abenteuer ihn seinen Job kosten und zu einer Rückversetzung nach Reuß-Schleiz-Greiz führen könnte. Er nimmt dieses existenzielle Risiko als ständiger „Erregungssucher“ auf sich, der mit einer „Gier nach immer neuen und intensiveren Erlebnissen für Verführungen empfänglich“ ist.

Poster for the Steve McQueen movie “Shame” starring Michael Fassbender.
Aus heutiger Perspektive könnte man von typischen Anzeichen einer Sexsucht sprechen, d.h. einer Form von Depression, die durch gefühlte Leere entsteht und mit einem Übermaß an sexueller Betätigung kompensiert wird, die allerdings keine Befriedigung verschafft, sondern eher Leistungs- und Leidensdruck. Das Suchthafte wird vom Grafen selbst thematisiert. Er will aufhören mit dem ewigen Weiterrennen von Affäre zu Affäre: „Was nützt der gute Vorsatz mir? Klopft ein Versucher an die Tür, dann ist vergessen die Moral. Ich denke: ‚Nur noch dies eine Mal! Von morgen an wird‘ ich solid!‘ Ach, lieber Gott! ‘s ist ein altes Lied! Und morgen, ach, ja dann … Fang ich von vorne an!“
Jeder, der den Film Shame gesehen hat, wird hier klassische Verhaltensmerkmale wiedererkennen. Natürlich gab es um 1899 den Begriff Sexsucht noch nicht, aber das Verhaltensmuster eines lust-a-holic war in den Lebemann- und Lebeweltkreisen Wiens nicht unbekannt. Besonders in jenen adeligen Kreisen, in denen Männer zu viel Zeit zum Nichtstun hatten und das Vakuum mit Liebeleien zu füllen versuchten, die geradezu zum normativen Verhalten ihres Standes dazugehörten. In diesem Punkt ist das Libretto von Léon/Stein auffallen zeitgemäß. Denn wiederum wird eine gesellschaftliche Umbruchsituation beschrieben, die uns heute – in Zeiten von Cybersex, Online-Pornographie und Dating Apps – vertrauter denn je vorkommen sollte.
Einen Sexsüchtigen, der zu viel „Wiener Blut“ in sich hat, wird man nicht mit Eifersucht à la Franzi kurieren, auch nicht mit Solidität à la Pepi. Aber eine verständnisvolle und aufgeschlossene Ehefrau wie die Gräfin Zedlau wäre, wenn überhaupt, jemand, der solch einem Mann helfen und mit dem er ehrlich glücklich werden könnte; ohne sie in die Co-Abhängigkeit zu ziehen. Und weil Operette nicht Tragödie oder Psychodrama ist, wenden die Librettisten das angedeutete Suchtproblem ins Positive, ins Happyend. Graf und Gräfin kommen zueinander, um sich gegenseitig respektierend und unterstützend gemeinsam durchs Leben zu gehen – als Verbindung, die gerade weil sie aus der Norm herausbricht und diese teils auf den Kopf stellt, die größte Wahrscheinlichkeit von allen drei Paaren auf dauerhaftes Glück hat.
Um all das zu erkennen und Wiener Blut von der ewigen Nostalgie und Süßigkeit zu befreien, ist es notwendig, sie und die gesamte Gattung Wiener Operette aus dem „Vorhof der großen Kunst“ herauszuholen. Und sich bei dem Stück auf die ureigenen Qualitäten des Genres zu konzentrieren, die Victor Léon und Leo Stein bestens kannten und bestens bedienten. Mit anderen Worten, mit „pietätvoller und dankbarer Stimmung“, wie das Publikum der Uraufführung 1899, sollte man dem Werk nicht begegnen. Mit Operngesang und philharmonischen Weihen ebenfalls nicht.
Damit tut man weder Strauss, noch Léon/Stein einen Gefallen, geschweige denn “Wiener Blut”, dessen „Saft“ und „Kraft“ sich nur bei anderer Akzentsetzung zu erkennen gibt, dann aber als „heiße Flut“.
Im Oktober 2014 ist eine kritische Neuausgabe der Partitur sowie des Textbuchs bei der Verlagsgruppe Hermann erschienen, im Rahmen der Neuen Johann Strauss Gesamtausgabe, herausgegeben von Michael Rot. Vielleicht ermöglicht diese Neuausgabe ja eine grundsätzliche Neubewertung des Stücks in einer veränderten Operettengegenwart – die das Erbe von Willi Forst sowie das Ideal von Dagmar Koller im Schlüpfer und durchsichtigen Negligee hinter sich gelassen hat, und Wiener Blut als vollwertigen Beitrag zur Moderne neu entdeckt? In einer Ausgabe der Zeitschrift Opernwelt 2015 hieß es, „deutsche Operetteninszenierungen“ hätten „lange den systemtragenden und nicht den brüchigen Charakter der vorgelebten Gesellschaftsnormen betont“.

Typical “pornographic” drawing by Johann Strauss.
Autor Michael Struck-Schloen schreibt: „Die Aufgabe, aus der angestaubten Popularität der alten Schlager Wahrheiten über das Lebensgefühl des 21. Jahrhunderts zu destillieren, ist knifflig.“ Die Aufgabe ist aber nicht unmöglich zu lösen. Und sie ist – besonders im Fall von Wiener Blut – lohnend, wenn man den Staub von „tausend Jahren“ beiseite wischt und mit offenen Augen ins frisch herausgegebene Zensurlibretto von Léon/Stein schaut, wo sich genügend Wahrheiten übers Lebensgefühl des 21. Jahrhunderts finden, auch wenn diese ins Kostüm eines „goldigen“ Alt-Wien verpackt sind.
Gerade dieser Kontrast macht den Reiz des Stücks aus und die Genialität von Victor Léon und Leo Stein, die aus dem rauschhaften Titelwalzer – neu arrangiert von Adolf Müller Jr. – ein Fanal der neuen, sexuell befreiten Zeit machen. Das entspricht vielleicht nicht dem goldigen Strauss-Image, das die österreichische Touristikbranche und der ORF zum alljährlichen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gern promoted, aber es entspricht durchaus dem realen Menschen Johann Strauss und seiner pulsierenden Musik.

Johann Strauss and his first wife, Jetty Trenfz, a famous Viennese courtesan who had seven illegitimate children and introduced Strauss to the demi-monde world of operetta.
