Kevin Clarke
klassik.com
23 April, 2016
Wenn man seine Dissertation über ein Werk wie Die Herzogin von Chicago geschrieben hat, wenn man all die Aufnahmen von 1928 gehört hat, all die Rezensionen aus der Wiener und Berliner Presse gelesen hat, wenn man sich die vielen großartigen Bühnenfotos angeschaut hat von den unglaublichen Stars der Epoche (Hubert Marischka, Max Hansen, Rita Georg, Hans Moser et al), wenn man das Textbuch von Brammer und Grünwald vorwärts und rückwärts gelesen hat – dann fällt es schwer, eine neue Produktion dieser Charleston-Operette von Emmerich Kalman unvoreingenommen zu betrachten oder zu beurteilen.
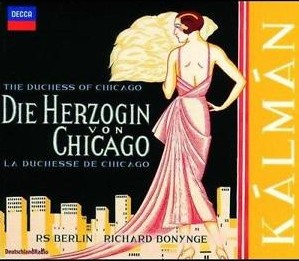
CD cover for “Die Herzogin von Chicago”. (Decca)
Zur Erinnerung: Das Stück wurde 1999 von CD-Produzent Michael Haas in die Decca-Reihe „Entartete Musik“ aufgenommen, als einzige Operette. Es folgte ein Boom, der das Stück – in dem Kalman sich am weitesten in Richtung Broadway und amerikanische Jazzmusik bewegt hat – auf viele Bühnen im deutschsprachigen Raum brachte. Es gab eine sehr schöne Produktion in Osnabrück, wo das Originalbühnenbild als Skizze verwendet wurde und der komplette Originaldialog, mit allen Judenstern- und Religionswitzen des jüdischen Autorengespanns, das nach 1938 ins Exil gehen musste. Für einen historisch interessierten Operettenforscher wie mich war das natürlich ein Traum, so etwas zu sehen, auch wenn der Osnabrücker Vorstellung jeglicher Glamour und Pepp fehlte. Später gab’s eine stark bearbeitete Neufassung an der Volksoper Wien, die auch auf DVD erhältlich ist, und die der reinste Operettenhorror ist, weil niemand den typischen Broadwaytonfall Kalmans trifft und sich alle sehr steif in diesem Stück über Charleston vs. Csardas bewegen. Auch der Versuch der Staatsoperette Dresden unter Dirigent Ernst Theis war 2005 mehr bemüht als überzeugend. Irgendwie schienen die Operettenmannschaften der einschlägigen Theater sich schwer zu tun mit diesem Idiom und den allesentscheidenden Tanzsequenzen. Von der glücklichen konzertanten (Kurz)Version an der Komischen Oper Berlin 2014 unter Dirigent Florian Ziemen gab’s immerhin einen Radiomitschnitt, mehr leider nicht.

Poster for the 2016 production of “Herzogin von Chicago” in Budapest. (Photo: Budapesti Operettszínház)
Jetzt hat das Budapester Operettentheater (BOT) das Werk neu herausgebracht, in einer vollkommen überarbeiteten Fassung, wo nahezu alle Dialoge neu sind und fast alle Musiknummern irgendwo gelandet sind, wo sie ursprünglich nicht waren, plus mehrere Einlagen aus Kalmans Woodoo-Operette Golden Dawn (Broadway 1927) und der Filmoperette Ronny (1931) ihren Weg in die Show gefunden haben. Ich muss gestehen, dass dieses Neue für mich beim ersten Sehen ein Schock war. Aber glücklicherweise durfte ich in Budapest die ganze Woche alle Proben sehen und damit das Werk mehrmals mit wechselnden Besetzungen erleben.
Die Operettenboys von Budapest
Nachdem der erste Schreck überwunden war, bin ich dieser Produktion vollkommen verfallen. Warum? Da wären zuallererst die Tänzer_innen zu nennen. Eine derart rasante Operettenchoreographie habe ich seit langem nicht gesehen; im Grunde wäre da Otto Pichler an der Komischen Oper die einzige ernsthafte Konkurrenz. Und genau wie Pichler und Regisseur Barrie Kosky ihre Operettenboys meist halbnackt über die Bühne fetzen lassen, so haben sich die BOT-Tänzer (selbst!) entschlossen, nackte Haut zu zeigen. Sie tun das nicht ganz so explizit (homo)erotisch wie die Berliner Kollegen, aber sie sind allesamt Hingucker und tanzen fantastisch in den ausgiebigen Charleston- und Foxtrottszenen, die Johanna Bodor choreographiert hat.
Die Überraschung ist allerdings, dass das BOT für die Csardasszenen einen weiteren Choreographen engagiert hat, den jungen Volkstanzexperten Gábor Lénárt. Was der mit der zweiten Tanzgruppe in Folklore-Outfits macht, kann einem die Sprache verschlagen. Der große Csardas des Tenors im Vorspiel wird zu einer derart fulminanten Nummer, dass es bei der Premiere Standing Ovations gab. Das liegt auch daran, dass der Darsteller des Prinzen an dem Abend, Musical-Superstar Attila Dolhai, überwältigend tanzen kann – wie übrigens auch Uraufführungsdarsteller Hubert Marischka. Ich muss gestehen, dass alleine diese Szene die Reise nach Budapest für Kalman-Fans zum Pflichtprogramm macht. Denn so etwas kann man nicht einmal bei Pichler/Kosky in Berlin sehen. Und das will etwas heißen!
Überhaupt ist die Besetzung dieser Produktion außergewöhnlich. Es geht ja darum, dass eine superreiche junge Dame aus Chicago nach Europa kommt und dort alles aufkauft, was nicht niet- und nagelfest ist.
Außerdem will sie mit ihrer eigenen Jazzband den konservativen Europäern zeigen, wie viel überzeugender Charleston und Foxtrott sind, statt Wienerwalzer. Es wird ein Zusammenprall der Kulturen: Neue Welt gegen Alte Welt, Mary Lloyd gegen Prinz Boris Sandor. Die Budapester Mary ist Barbara Bordás. Auch sie tanzt und spielt phänomenal, was bei Operettenprimadonnen heute keine Selbstverständlichkeit ist. Vor allem schafft sie es, ihre Operettenstimme so einzusetzen, dass sie wie eine natürliche Musical-Sängerin klingt. Dadurch wirken die großen Nummern „Wie Ladies aus Amerika“ und „Ein kleiner Slowfox mit Mary (bei Cocktail und Sherry)“ niemals affektiert, sondern kommen mit der Selbstverständlichkeit über die Rampe, die 1928 Rita Georg vorgeführt hat; nachzuhören auf Tonträger. Auch die Zweitbesetzung der Mary Lloyd, Mónika Fischl, trifft diesen Ton perfekt. Es ist eine Freude diesen Solisten zuzuhören.
Das gilt auch für die Buffos: Szilvi Szendy als leicht demente Prinzessin von Moranien, in voller Folkloretracht und mit einem deutlich faschistischen Vater, der sie jungfräulich an Prinz Boris verheiraten will, ist umwerfend komisch. Einen derartigen Slapstick-Humor mit perfektem Timing und perfektem Tanz findet man in der Operettenwelt sonst selten. (Alternativbesetzung Annamaria Dancs ist auf andere Weise auch sehr überzeugend, vor allem weil sie mit einem Provinzdialekt spricht, der das Publikum immerzu zum Lachen bringt.) Daneben glänzen als stepptanzende Privatsekretäre Mr. Bondy Péter Laki und Miklós Máté Kerényi.

The four buffos: Miklós Máté Kerényi, Annamaria Dancs, Szilvi Szendy, Péter Laki (left to right). (Photo: Bea Miko/FotoIrodalomSzinhaz)
Faschistische Schatten
Mit diesem Doppelquartett sowie einen Schar von exzellenten Nebendarstellern scheut sich der Regisseur Attila Béres nicht, in der heute noch sehr aktuellen Geschichte die dunklen Nationalismus-Aspekte deutlich herauszuarbeiten. Wenn Prinz Boris Sandor mit seinen Männern in schwarzen Ledermänteln auftritt und die Jazzmusiker aus dem Lokal schmeißt, dann ist auch optisch klar, aus welcher ideologischen Ecke der Wind weht. Und genau darum geht es in dem Stück – genau deshalb hatte Michael Haas das Stück damals in die „Entartete Musik“-Reihe aufgenommen. Auch später führt Regisseur Béres die gefährliche und zugleich lächerliche faschistische Einstellung von größenwahnsinnigen Balkanfürsten vor, und Imre Sipos als Großherzog von Moranien spielt das gespenstisch gut.

Poster for the “Golden Dawn” movie.
Eine der Neuerungen dieser Neufassung von Attila Lörinczy ist die Figur von Großfürstin Lizaveta, Mutter von Prinz Boris Sandor. Mit ihr bekommt Alt-Diva Zsuzsa Kalocsai eine wunderbare Rolle mit viel neuer Musik. Eines der neuen Lieder ist der Afrikawalzer aus Kalmans Broadwayoperette Golden Dawn. Der klingt in der Hollywoodfilmfassung des Stücks nicht sehr überzeugend, aber so wie Kalocsai ihn hier mit neuem Nostalgietext singt, ist das ein weiteres Highlight des Abends. Überhaupt ist Kalocsai einer der Gründe, warum Operettenfans diese Aufführung sehen sollten, denn sie bringt in das Charleston-Chaos rundherum jene Aura der Vergangenen, die eine perfekte Balance erzeugt.

Diva Zsuzsa Kalocsai in one her glorious moments in “Herzogin von Chicago”. (Photo: Bea Miko/FotoIrodalomSzinhaz)
Utopisches Finale
Über die vielen weitere Änderungen und Umstellungen könnte man noch viel sagen. Man merkt auch, dass der Regisseur mehr am ersten Teil des Abends gefeilt hat und sich im zweiten Teil nicht mehr so viele punktgenaue Details finden (zum Beispiel die Stummfilmeinblendungen vom Anfang oder die Pantomimemomente mit Klavierbegleitung vom Vorspiel, die nicht zurückkommen). Aber es bleibt eine Leistung, Kalman-den-Nationalheiligen in Budapest derart modern auszumusizieren, so wie er selbst das für die Herzogin komponiert hat. Mir persönlich ist keine andere zeitgenössische Aufführung bekannt, wo das derart radikal gelungen wäre. Und das ist eine Leistung, die diese neue Herzogin von Chicago weit hervorhebt aus der Masse des derzeitigen Operettenrevivals.
Der Luxus, sich für dieses Stück drei Choreographen zu leisten (die Dritte ist Anita Hajdu für die Steppszenen) hat sich ausgezahlt.
Und auch die neue Instrumentation von Tamás Bolba überzeugt weitgehend mit knackigem Musical-Sound. Dieser wahrt jedoch Kalmans Originalidee, eine extra Jazzband und eine extra Folklorekapelle auf der Bühne einzusetzen. Die improvisierten Jazz-Szenen mit den drei Musikern zwischendurch sind eine Kalman-Offenbarung. Und am Ende sitzen die sechs so verschiedenen Musiker friedlich zusammen und musizieren gemeinsam, so wie Kalman das intendiert hat. Ein toller Schluss, 1928 in Wien und 2016 in Orbans Ungarn.
